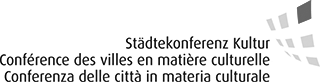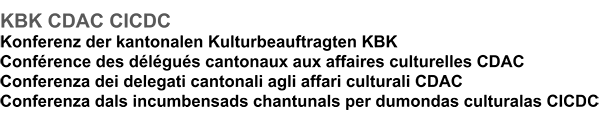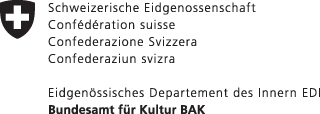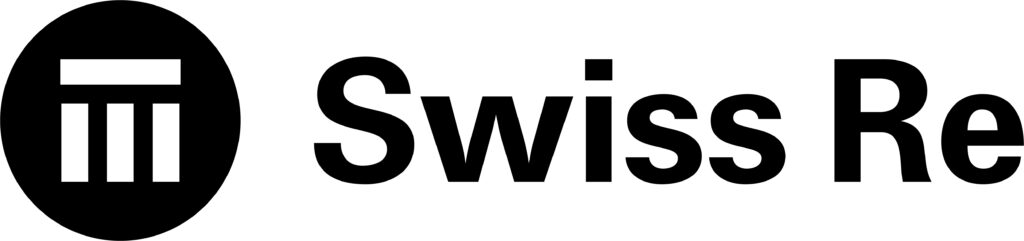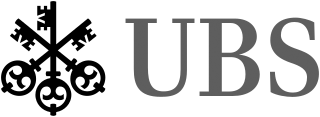Tagung 2007
Vom Internet verweht
Etwas rinnt uns durch die Finger – nicht nur der Kulturteil, den die Berner Zeitung künftig über das restliche Blatt verstreut, den andere zurückschneiden und in Lifestyle umbenennen. Dass das Feuilleton nicht rentiert, das wussten wir schon immer, aber es war für das Verstehen der Welt unerlässlich und hat darum einen Profit jenseits des Aktienkurses abgeworfen. Aus dem viele Zeitungen ihr Prestige bezogen. Was uns heute bedrückt, ist der Kulturwandel. Dem Schwinden des Feuilletons entspricht der sinkende Stellenwert von Kultur in der Gesellschaft. Die jüngste Univox-Befragung hat den Beweis geliefert: Kultur ist jener Lebensbereich, der bei den Schweizern in den letzten Jahren (neben der Politik!) am meisten an Bedeutung verloren hat. Im Gegensatz zum Sport, der auf die vorderen Ränge gerückt ist; Sport ist jetzt der relevante Träger von Wertvorstellungen.
Natürlich, auch das ist die Schuld der Medien. Wirklich? Auch die Medien reagieren nur auf Trends, die sie bestenfalls verstärken. Man muss schon tiefer graben. Und kommt zum Schluss: Kultur ist nicht mehr jenes Leitmedium, zu dem sie sich nach 1968 erhoben hatte. Damals ging es um eine Kulturrevolution, mitsamt Marx, „Kapital“ und Rolling Stones. Der Fall der Mauer hat Kultur entpolitisiert, das Internet hat sie zu einem Gratis-Konsumgut degradiert, die Fülle der neuen Institutionen hat eine Art kulturellen Frieden geschaffen. Der Erfolg von 40 Jahren Kulturpolitik: Kultur ist für viele zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Also zu etwas, über das man verfügt, nach dem man nicht mehr streben muss.
Deshalb stellten 100 Vertreter der öffentlichen und privaten Kulturförderung sich am 15. und 16. März in Solothurn die Frage, wie es mit "Medien ohne Kultur, Kultur ohne Medien" weitergeht. Denn das Verschwinden des Kulturteils bringt die Kulturpolitik in Nöte. Es verschwindet jene Plattform, auf der sie ihre Kriterien öffentlich verhandelte. Jenes Forum, wo neue Entwicklungen gewürdigt und auf ihre Förderwürdigkeit geprüft wurden. Es löst sich auch jene Instanz auf, welche Kulturpolitik verhandelte. Der Wind hat den Sand der Ideologien verweht.
Jetzt erst beginnt – Kulturpolitik. Nicht, um das Rad der Zeit anzuhalten. Sondern um der Kultur in der herrschenden Diktatur der Zahlen und Aktienkurse Platz zu schaffen. Kultur ist noch immer Menschenbildung, sie ist noch immer jener Raum, in dem wir uns über die Gegenwart, über Nöte, Probleme und Alltagspolitik hinausbewegen. Kultur ist Denken und Empfinden auf einem anderen Orbit. Wenn sie es künftig ohne Hilfe der Medien tun muss, ist das bedauerlich. Aber sie wird neue Formen von Öffentlichkeit finden. Im Internet zum Beispiel. Kultur ist, tröstlich genug, immer das Problem und seine Lösung zugleich. Letztere mag Blog heissen oder Podcast oder YouTube oder MySpace, digitales Radio oder Internetfernsehen.
Für die Kulturpolitik bedeutet das: Weniger zeitgeistige Projekte, mehr kulturelle Gefässe fördern, in denen Auseinandersetzung mit der Gegenwart, mit Wahrnehmungen und Visionen sich abspielen kann. Keine Vorlieben mehr, sondern Spielräume, in denen die Kultur Geschichte schreibt. Mehr Diskussion in unseren Gremien. Mehr gesunder Streit. Der sich in den neuen Öffentlichkeiten spiegelt. Ob die traditionellen Medien solches überleben, bezweifle ich. Macht aber nichts; die Kultur wird sie nicht mehr benötigen.
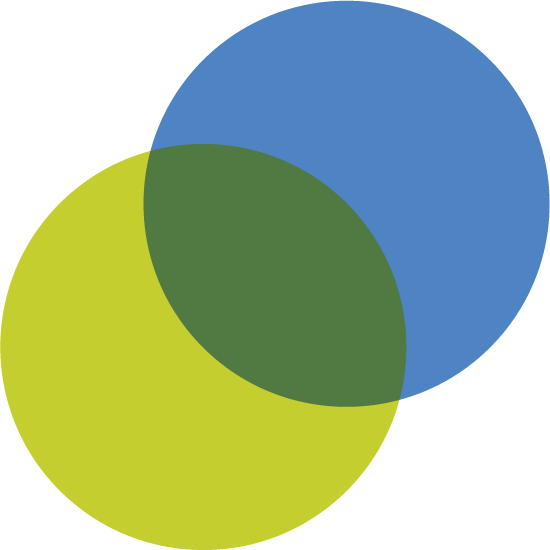
Programm
Donnerstag, 15. März 2007
PDF Programm
GELD REGIERT
- 09:00
Begrüssungskaffee
- 09:30
Intervention Com&Com
- 09:35
Konrad Tobler, Bern, freier Kulturjournalist und Kunstkritiker
“Feuilleton über das Feuilleton; Plädoyer für einen starken Kulturjournalismus.“
Die Kulturteile verlieren an Raum und entsprechend auch an Profil. Gedankensprünge darüber, weswegen dem entgegengewirkt werden sollte – und ob das überhaupt möglich ist.- 09:45
Pius Knüsel: allocution de bienvenue, introduction au thème
- 10:00
Raphaëlle Aellig Régnier, Genf, Fernsehjournalistin und freie Produzentin
„Faut-il protéger la place de la culture dans les médias? L’artiste, est-il devenu l’otage des médias?“
Les pages et émissions culturelles cèdent leur place aux célébrités. Comment réagir au schisme final de médias et culture, quelle pourrait être la place future de la culture, mais tout d’abord: de quelle culture on parle?- 10:40
Pause
- 11:10
Intervention Com&Com
- 11:15
Norbert Bolz, Berlin, Medienwissenschaftler, Professor an der Technischen Universität Berlin:
„Infotainment – Über den Parajournalismus der Laien und den Postjournalismus.“
Zum Bedeutungswandel der Printmedien. Der klassische Journalismus sieht sich in der Krise, neue, internet-basierte Formen von Publizität gewinnen an Boden.- 12:00
Lunch
- 14:00
Hedy Graber: Einleitung zum 2. Teil
- 14:10
Kurt W. Zimmermann, Zürich, Medienanalyst und -Kritiker
“Kultur in den Medien – ein überschätztes Programm für Minderheiten.“
Im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Gruppen leidet die Kulturszene an einer permanenten Selbstüberschätzung. Das verzerrt ihr Verhältnis zu den Medien, und umgekehrt ist das Verhältnis der Medien zur Kultur.- 15:00
Workshops
- 17:10
Intervention Com&Com
- 17:15
Karl Karst, Köln, Programmleiter des Kulturradios WDR 3:
“Hoffnung am Horizont: Kulturradio als Medieninstanz.“
WDR 3 ist das Kulturradio des Westdeutschen Rundfunks. Mit 1,6 Millionen regelmässsigen Hörern gehört es zu den erfolgreichsten seiner Sparte. Das war nicht immer so. Warum der Erfolg? Und was kann das Radio tun, um als Kulturmedium begriffen zu werden?- 17:45
Fragen, Schlussrunde
- 18:15
Abschluss
- 19:00
Aperitif offeriert von der Solothurner Kantonsregierung
Grusswort Klaus Fischer, Regierungsrat
Soirée conviviale
Freitag, 16. März 2007
PDF Programm
HOFFNUNG KEIMT
- 08:30
Hans Ulrich Glarner: Begrüssung zum 2. Tag
Résumé des 1. Tages und der Diskussionsworkshops- 08:40
Peter Buri, Aarau, Chefredaktor der AZ-Medien:
“Politik ist nur das halbe Leben. Wie man mit Kultur Leserinnen in die Zeitung holt.“
Gegen den Trend haben Aargauer Zeitung/Mittelland Zeitung 2005 der Kultur mehr Platz und einen eigenen Zeitungsbund zur Verfügung gestellt. Wieso? Welche Chancen bieten sich dem Kulturjournalismus aus verlegerischer und redaktioneller Sicht? Und welchen Stellenwert hat die Kultur in den Printmedien und in den privaten elektronischen Medien der Zukunft?- 09:30
Sima Dakkus, Lausanne, Rédactrice en chef de CultureEnJeu
“Culture EnJeu: Voix des artistes.“
Pour la défense des ressources de l’art et des créateurs.- 09:50
Intervention Com&Com
- 10:00
Workshops 2. Reihe und Pause
- 12:05
Niggi Ullrich, Liestal, Kulturbeauftragter Basel-Landschaft
“Abschied von den Medien.“
Herausforderungen für die Kulturförderung.- 12:20
Bruno Giussani, Tessin, Blogger, Internet-Experte und Autor
“L’impact culturel de l’internet participatif.“
Blogs, wikis, video-sharing, journalisme „citoyen“, etc.: Les nouvelles formes de communication participative sont en train de changer l’Internet. De quoi s’agit-il ? Comment fonctionnent-elles ?
Quel est leur impact socioculturel?- 13:00
Schlussrunde, Ausblick
- 13:30
Intervention Com&Com
- 13:45
Lunch und Abschied